MP Enkhbold
Die Deutsche Mongolei Agentur aus Ulaanbaatar präsentiert:
von Dr. Renate Bormann, Ulaanbaatar / Berlin
MP Enkhbold
Regierungskrise vorerst beigelegt
Die Mongolen gehen ins Jahr des Roten
Hundes mit einer neuen Regierung.
Protestdemonstrationen mit mehr als 1 500 Teilnehmern, u. a. initiiert von den
„Gelben Halstüchern", das versuchte Erstürmen des MRVP-Gebäudes – dabei wurde
die MRVP-Flagge verbrannt – haben den Rücktritt der Elbegdorjregierung nicht
verhindern können.
Am 13. Januar beschloss der Große Staatskhural, den Rücktrittsgesuchen der zehn
MRVP-Minister zuzustimmen. 39 der 76 Abgeordneten, darunter Enkhsaikhan und
Narantsatsralt von der DP, Gundalai (Ex-DP-Präsidiumsmitglied, jetzt
Vorsitzender der von ihm gegründeten Volkspartei), Jargalsaikhan
(Republikanische Partei) und Erdenebat (Mutterlandpartei) stimmten für den
Rücktritt. Damit waren Ministerpräsident Ts. Elbegdorj und seine DP-Minister
nicht mehr zu halten. Proteste kamen von der Bürgermut-Republikanischen Partei
und von den DP-Abgeordneten um Gonchigdorj und Elbegdorj.
M. Enkhbold, der Vorsitzende der MRVP, wurde von seiner Partei als Nachfolger
von Elbegdorj nominiert.
83,3 Prozent der anwesenden Mitglieder stimmten auf der Parlamentssitzung am 25.
Januar für ihn. M. Enkhbold ist der 23. Ministerpräsident der Mongolei. Er wird
einer „Regierung der Nationalen Einigkeit" vorstehen.
Am 28. Januar unterbreitete er dem Großen Staatskhural seine Personalvorschläge
für die neue Regierung. Nach Diskussionen, die bis zum Morgengrauen dauerten,
akzeptierten die Abgeordneten die Minister. Lediglich N. Chuluunbaatar
(Mutterlandpartei), der für das Amt des Ministers für Besondere Angelegenheiten
vorgesehen war, fand keine Mehrheit.
M. Enkhsaikhan
Dem neuen Kabinett gehören an:
Kurzbiographie von MP Mieegombo Enkhbold
Enkhbold wurde 1964 in Ulaanbaatar geboren,
er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.
Von 1999 bis 2005 war er Oberbürgermeister von Ulaanbaatar. Seit Sommer
2005 ist er der Vorsitzende der MRVP, im September desselben Jahres gewann er
die Nachwahlen im Wahlkreis 65 um einen Sitz im Großen Staatskhural.
Mongoleistand Grüne Woche 2006. V. l. Hostess, Bayanmunkh, Bolor
Mongolei erstmals auf „Grüner Woche" in Berlin
vertreten
Die Internationale Grüne Woche fand 2006
zum 71. Mal statt und zum ersten Mal beteiligten sich mongolische Firmen der
Nahrungs- und Genussmittelindustrie an dieser größten Landwirtschafts- und
Gartenbauausstellung der Welt.
Dr. Purevjavyn Bayanmunkh, der Leiter der mongolischen Delegation, äußerte
Genugtuung über die Möglichkeit, mongolische Firmen und ihre Produkte nicht nur
den Berlinern und Gästen aus den anderen Bundesländern, sondern auch einem
internationalen Publikum vorstellen zu können.
Bayanmunkh ist Abteilungsleiter im Ministerium für Land- und
Nahrungsgüterwirtschaft, er wird begleitet von drei Ministerialbeamten und zehn
Unternehmensvertretern der Firmen APU, Spirt Bal Buram, Jem International,
Beneduct (Getränkehersteller), Khatansuikh Impex (Wurst- und Fleischwaren) sowie
des Naturfleischzentrums Erdenet, ein mongolisch-deutsches
Gemeinschaftsunternehmen von TBD Anduud und Gausepohl. Unterstützt wird diese
Partnerschaft durch die zur KfW-Bankengruppe gehörende
Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG).
Nicht unerwähnt bleiben soll das Engagement von Landwirtschaftsminister und
Ex-Botschafter D. Terbishdagva und der mongolischen Botschaft in Berlin, die mit
Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums die mongolische Beteiligung an
der diesjährigen Grünen Woche erst möglich machten.
Auf 30 Quadratmetern in der Halle 4.2, in der auch Kasachstan und die deutschen
Bierbrauer ausstellten, boten die Mongolen Arkhi (Wodka), Fruchtsäfte,
Heidelbeer- und Sanddornliköre, Wildbeerenmarmelade, Hammel- und
Pferdefleischkonserven an.
Natürlich erhofften sie sich gute Geschäftsabschlüsse, aber noch wichtiger war
ihnen, laut Bayanmunkh, einen Schritt näher an den europäischen Markt zu kommen.
Diesem Zweck dienten erklärtermaßen auch die Gespräche im Wirtschafts- und im
Landwirtschaftsministerium, mit potenziellen deutschen und mongolischen
Partnern.
Bayanmunkh und die Botschaftsmitarbeiter Bolor und Erdenetsogt betonten darüber
hinaus, dass die Mongolen ihren Auftritt auf der Grünen Woche 2006 als Beginn
einer langfristigen und kontinuierlichen Werbekampagne für die Mongolei und ihre
Land- und Viehwirtschaftsprodukte auf dem deutschen und europäischen Markt
ansehen.
Besorgnisse wegen der Vogelgrippe konnte Bayanmunkh ausräumen. In der Mongolei
gäbe es keine nennenswerte Geflügelhaltung, Gefahr für den Menschen durch
heimische Wildvögel und Zugvögel drohe nicht. Zur Ernte 2005 meinte der
Landwirtschaftsexperte, sie sei zwar bei Getreide unterdurchschnittlich
ausgefallen, demgegenüber seien die Erträge bei Kartoffeln und Gemüse im
Vergleich zum Jahr 2004 gestiegen.
Der mongolische Delegationsleiter, der zum ersten Mal Deutschland besuchte,
bedauerte es sehr, so gut wie nichts von der deutschen Hauptstadt gesehen zu
haben – bereits am 19.01. musste er zurück in die Mongolei fliegen.
Über einen Mangel an Besuchern konnten sich die Mongolen an ihrem Stand nicht
beklagen. Vor allem am Wochenende hatten die Standbetreiber und ihre Helfer,
darunter mongolische Studenten und Studentinnen aus Berlin, alle Hände voll zu
tun, Chinggis- und Khubilai-Arkhi, Sanddornsaft und Beerenlikör einzuschenken.
Und es hat allen geschmeckt.
Die „Grüne Woche" auf dem Berliner Messegelände endete am 22. Januar.
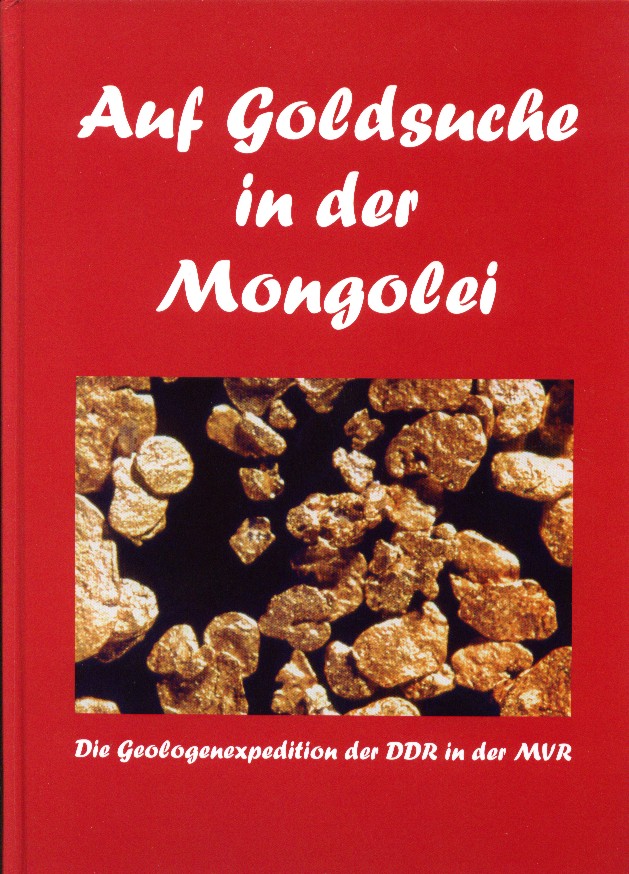
Neuerscheinung: Auf Goldsuche in der Mongolei
Auf Goldsuche in der Mongolei
„Vergessen heißt kostbare Erfahrungen zum
Fenster hinauswerfen". Diesen Satz von Arthur Schopenhauer haben die Herausgeber
des Erinnerungsbandes „Auf Goldsuche in der Mongolei. Chronik der
Geologenexpedition der DDR in der MVR" zum Motto ihres Buches gewählt.
Eindrucksvoll stellen der Diplomingenieur Joachim Stübner aus Dresden, der
Diplomgeologe Dr. Aribert Kampe aus Berlin und der Diplommineraloge Reinhard
Schirn aus Freiberg diesen Satz unter Beweis.
Zu den Autoren des Buches gehören Geologen, Bergleute, Markscheider, Chemiker,
Ärzte, Studenten, Mechaniker und Köche, die in den Jahren zwischen 1960 und 1970
in der Mongolei lebten und arbeiteten.
Der Band enthält nicht nur fachspezifische Darstellungen über die Expedition und
die Geologie der Mongolei, über Landesprofil, allgemeine Geschichte und Bergbau.
Persönliche Eindrücke und Erlebnisberichte der Expeditionsteilnehmer und anderer
Spezialisten in der Mongolei nehmen einen erfreulich breiten Raum ein, werden
mit Fotos aus Privatbesitz ergänzt, die dem heutigen Betrachter und Kenner des
Landes eindrucksvoll die Veränderungen im zentralasiatischen Land zwischen
Russland und China „vor Augen" führen.
Botschafter Galbaatar verrät, wie die Autoren von Mongoleibildbänden in den
50-er, 60-er und 70-er Jahren den Fortschritt auf ihre Fotos „gezaubert" haben:
Sage und schreibe vier, fünf Autos wurden organisiert und auf der Hauptstraße
Ulaanbaatars, der Straße des Friedens, platziert. Sieh’ an: Reger Autoverkehr
auf Ulaanbaatars Straßen. Wer die Straße des Friedens heute überqueren will, hat
zu jeder Tages- und Nachtzeit Schwierigkeiten, einen sicheren Weg zwischen
Fahrzeugen jeder Größe, jedes Baujahres und jedes Preises zu finden. Über
70 000 Kraftwagen machen heute die Straßen unsicher.
Auf einem der Fotos in der vorliegenden Chronik wird die Straße des Friedens, im
Hintergrund ist die Hauptpost zu sehen, so gezeigt wie es in den 60-er Jahren
tatsächlich auf den Straßen Ulaanbaatars aussah, ein einsamer Mopedfahrer hat
freie Fahrt ohne störende Ampeln, Fußgänger oder motorisierte Konkurrenten.
Die Geschichte mit der Möhrenlieferung aus China für die deutschen Geologen in
der Mongolei ist auch nur für „Nachleser" zum Lachen. Mongolische Zöllner
wollten die deutschen Freunde doch partout vor den Schrecken chinesischen
Gemüses bewahren. Heute kann ein Vegetarier durchaus in der Mongolei überleben,
damals hätte er in jedem Fall konvertieren müssen, aber auch die
fleischliebenden Deutschen wollten halt ab und zu ein paar Vitamine zu sich
nehmen und immer nur gegorene Stutenmilch und Wildzwiebel… Nach vielen
Diskussionen und sorgfältigen Auslesearbeiten durften die Deutschen Tage später
die wertvollen Möhren auslösen. Solche und ähnliche Begebenheiten schildern die
nicht immer konfliktfreie Annäherung der Menschen zweier unterschiedlicher
Kulturen. Gerade deshalb wirken die Aussagen über freundschaftliche Begegnungen,
gemeinsame Arbeitserfolge und Problemlösungen glaubwürdig, echt und lebendig.
In den letzten 35 Jahren hat sich in der Mongolei fast alles geändert – auch
Landschaft und Tierwelt. Doch noch immer verfügt das Land über einzigartige
Naturschönheiten und interessante Kulturdenkmäler. Die Menschen sind
aufgeschlossen, herzlich und neugierig auf alles Neue, ohne ihre Wurzeln zu
verleugnen.
„Auf Goldsuche in der Mongolei" will nicht nur Rückblick und Bestandsaufnahme
der oft schwierigen Arbeit der Geologenexpedition der DDR in der Mongolei sein,
sondern dem wachsenden Interesse in Ost und West an diesem faszinierenden Land
Rechnung tragen.
Mongoleikenner und -reisende aus den Ostländern werden angeregt, ihre damaligen
und heutigen Eindrücke und Erlebnisse zu vergleichen, lernen Neues und staunen,
diejenigen aus den Westländern können manches bisher Unbegreifliche an der
mongolischen Mentalität besser verstehen, Vorurteile abbauen und ebenfalls
staunen.
Die ausführlichen Namenslisten der Expeditionsteilnehmer und Studenten sind
allerdings eher für die Betreffenden selbst von Bedeutung, weniger für den
interessierten „Fremd"leser.
Das Buch umfasst 335 Seiten, einschließlich Anhang mit Begriffserklärungen,
Namenslisten sowie eines Grußwortes von Botschafter a. D. Lothar Zöllner.
Einige Anmerkungen zur Transkription: Die Transkription der mongolischen Begriffe im Buch basiert auf dem in der DDR gültigen (oft tatsächlich besser passenden und lesbaren) Transkriptionssystem, ist jedoch heute veraltet. Offiziell gilt die internationale ISO-Norm für mongolische Namen und Begriffe, die sich an die englische Schreibweise anlehnt: Sukhbaatar für Suchbaator (das ist in jedem Fall keine korrekte Schreibweise), Choibalsan für Tschoibalsan, Bayan Khongor (auf aktuellen Karten Bayankhongor) für Bajan Chongor usw.
Steppenmädchen-Chor
„Wer hat den Bananenmond gesehen?
„Steppenmädchen" begeistern in Großziethen
Das hatten die Großziethener nicht
erwartet: Im Rahmenprogramm ihres 1. Fußballhallenturniers am 22. Januar traten
junge Akrobaten, Sängerinnen und Tänzerinnen aus Ulaanbaatar auf. Mitreißende
mongolische und deutsche Lieder, atemberaubende Körperdrehungen der
Schlangenmädchen, traditionelle mongolische und moderne Tänze sorgten dafür,
dass den Zuschauern die Pause zwischen den Spielen fast zu schnell verging.
Die „Steppenmädchen" (Talyn Okhid), Schülerinnen der 38. Schule in Ulaanbaatar,
waren, erst drei Stunden zuvor aus Ulaanbaatar kommend, in Tegel gelandet. In
Großziethen (Gemeinde Schönefeld bei Berlin) begann ihre Tournee, die sie u. a.
nach Berlin, Krefeld, Mainz und Bremen führen wird.
Steppenmädchen
Einen großen Anteil daran, die sangesfreudigen
Schülerinnen aus der Mongolei in Brandenburg und Berlin begrüßen zu können, hat
der Hotelier Willi Belger. 2002 besuchte er mit seiner Frau zum ersten Mal die
Mongolei und hat sich regelrecht verliebt in das Land des Ewigen Blauen Himmels.
Er organisiert Sammelaktionen für Waisenhäuser, Kindergärten und Schulen in
Bayangol, dem Partnerstadtbezirk von Schönefeld. Ein großer Erfolg war der
„mongolischen Suppe" beschieden - ein Teil des Verkaufserlöses kam ebenfalls
aufs Spendenkonto. Jetzt beherbergt und verpflegt er zum zweiten Mal die jungen
Künstler und ihre Betreuer aus Ulaanbaatar – kostenlos, versteht sich.
Die diesjährige Deutschlandtournee der „Talyn Okhid" wird von 12 Schülerinnen
und ihren Deutschlehrern Martin Barenberg und Kazagvai Minjbadgar (Micki)
bestritten.
Herr Barenberg fungiert gleichzeitig als Chorleiter, Programmdirektor,
Organisator und Moderator. Micki kümmert sich um Wohl und Wehe der Mädchen.
Auf die Frage, ob es nicht sehr nervenaufreibend sei, 12 Teenager mehr als vier
Wochen lang zu „hüten", verweisen beide Betreuer auf das anstrengende Programm
und die im Vergleich zu ihren deutschen Altersgenossen stärker ausgeprägte
Disziplin mongolischer Kinder und Jugendlicher – nächtliche Diskobesuche würden
wohl eher die Ausnahme bleiben.
„Wer hat den Bananenmond gesehen?" summten am Ende der Vorstellung nicht nur die
jugendlichen Zuschauer, sondern auch die im gesetzten Alter mit. Nur ein kleiner
Junge interessierte sich nicht so sehr für die singenden und tanzenden Mädchen –
er erkundigte sich, wann es denn endlich mit dem Fußballspielen weiterginge.
Sogar die Elefanten frieren
Der russische Staatszirkus gastiert wie
jedes Jahr um diese Zeit in der Mongolei.
Wegen der anhaltenden Kälte – zeitweise bis minus 40 Grad – bekommen die
Zirkuselefanten zusätzlich mehrere Liter Schnaps zu trinken, um besser den
niedrigen Außentemperaturen trotzen zu können.
Hoffen wir, dass es geholfen hat.
Inzwischen ist es in Ulaanbaatar mit minus 15 Grad übrigens wärmer als in
Berlin.
Für das bevorstehende Mondneujahrsfest (29./30. Januar) wünschen wir alles Gute. RB
MongoleiOnline
Kurfuerstenstr. 54, 53115 Bonn, Germany
Copyright © 1997-2026 Frank Voßen
Last Update: 31. Dezember 2025